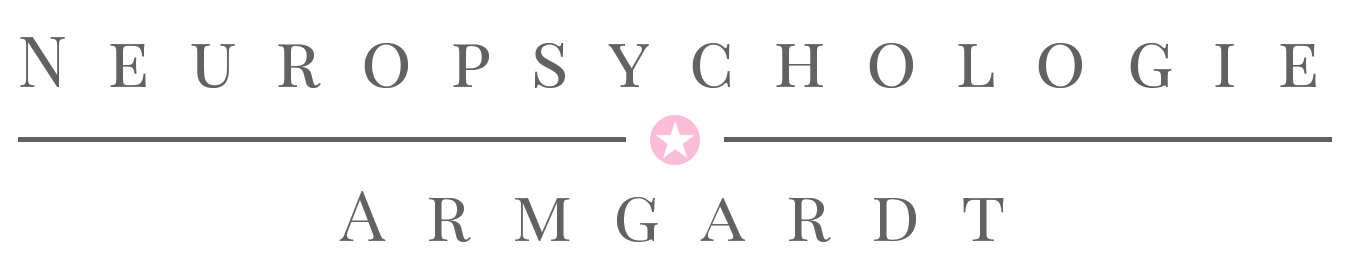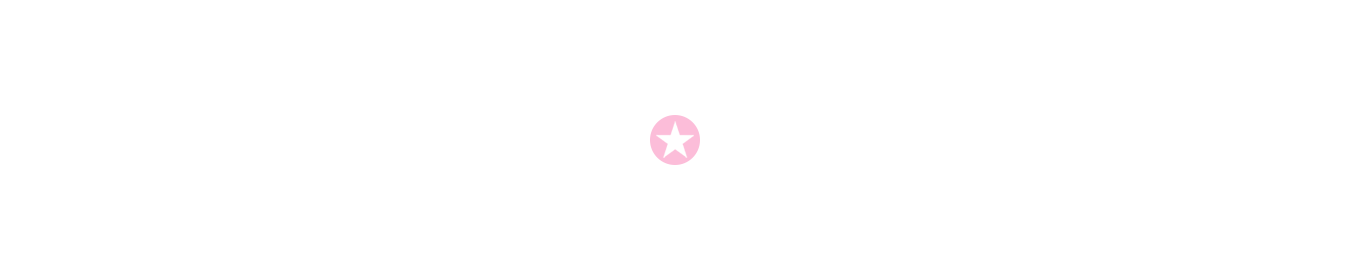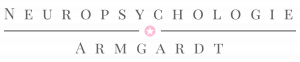Privatpraxis für Neuropsychologie
in Bremen, Oldenburg & Jever.
Wir – ein Team von hoch spezialisierten Neuropsycholog:innen – behandeln Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen.
Jeder Mensch ist einzigartig und so bieten wir Ihnen individuelle, angepasste Diagnostik-und Therapiekonzepte – passend zur jeweiligen Lebens- und/oder Arbeitssituation.
Was ist Neuropsychologie?
Neuropsychologische Diagnostik und Therapie dienen der Feststellung und Behandlung von hirnorganisch verursachten Störungen geistiger (kognitiver) Funktionen, des emotionalen Erlebens, des Verhaltens und der Krankheitsverarbeitung sowie der damit verbundenen Störungen psychosozialer Beziehungen.
Behandelt werden Menschen mit einer erworbenen Hirnschädigung.
Wir sind spezialisiert auf:
Wir sind für Sie da!
Nirgendwo sonst erhalten Sie so schnell einen Therapieplatz – wir realisieren kurze Wartezeiten.
An vier Standorten in Norddeutschland sowie deutschlandweit online, bieten wir neuropsychologische Diagnostik und Therapie für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an.
Für eine Diagnostik oder Begutachtung kommen Patient:innen aus ganz Deutschland zu uns. Wir helfen Ihnen gerne die Anreise und die Übernachtung zu organisieren, damit Sie ausgeruht und damit ausreichend belastbar für eine umfangreiche Diagnostik oder Begutachtung bei uns erscheinen.
Wir sind stolz darauf seit dem Beginn unserer Tätigkeit bereits ca. 1.500 Patient:innen therapeutisch auf ihrem Weg begleitet zu haben. Dabei steht immer eine schnelle Rückkehr zur sozialen und beruflichen Teilhabe unserer Patient:innen im Vordergrund.
Diagnostik- und Therapie
Als einer der größten Anbieter neuropsychologischer Leistungen verfügen wir über eine außerordentlich große Anzahl an Diagnostik- und Therapiematerialien, welche immer auf dem aktuellsten Stand sind. Diese setzen wir sowohl für die Betreuung in den Praxen, im eigenen Wohnumfeld oder am Arbeitsplatz bzw. in der Schule ein. Wir begleiten Sie auch gerne digital bei einem Hometraining.
Ortsunabhängig & sicher
Für eine ortsunabhängige und onlinebasierte Begleitung steht ebenfalls ein breites Spektrum an Tools zur Verfügung. Damit sind wir deutschlandweit für unsere Patienten erreichbar. Zielorientiertes Vorgehen und konsequenter Datenschutz sind dabei selbstverständlich.
Wissenschaftlicher Fortschritt
Alle Therapeut:innen nehmen regelmäßig an Supervisionen, Fortbildungen und Branchenkongressen statt. Wir arbeiten am Puls der Zeit und gestalten den technologischen Fortschritt der Branche aktiv mit. Standards und Fortschritt fordern wir täglich heraus.
Die Weitergabe unseres Wissens und Könnens liegt uns am Herzen. Bereits seit 2018 sind wir akkreditiertes Ausbildungsinstitut der Gesellschaft für Neuropsychologie e.V. (GNP).
Wir helfen Ihnen!
Vereinbaren Sie ein Erstgespräch, um uns und unsere Arbeit kennenzulernen, um Fragen zu klären und um einen ersten Eindruck von uns zu erhalten.